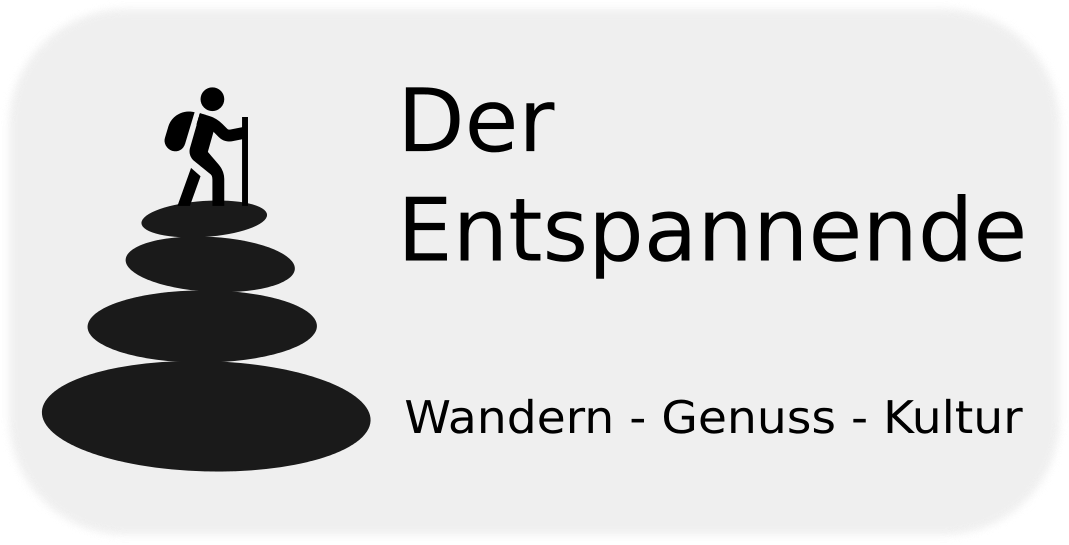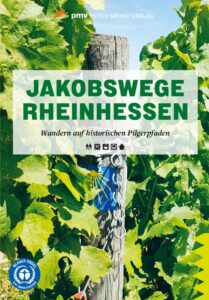Am 1. Juli waren wir im Artilleriewerk Fort de Schoenenbourg („Ouvrage de Schoenenbourg„). Nachdem wir am Freitag in Mietesheim für unseren Wanderurlaub angekommen waren, wollten wir aufgrund des noch unbeständigen Wetters und zum Eingewöhnen noch keine Wanderung übernehmen. Mich hatte schon vor Jahren bereits ein Besuch eine der Befestigungen der Maginot-Linie gereizt. So wanderten wir dreieinhalb Kilometer unter dem Elsass und der Erde durch die Tunnel.
Die Maginot-Linie ([maʒi’noː], französisch Ligne Maginot) war ein aus einer Linie von Bunkern bestehendes Verteidigungssystem entlang der französischen Grenze zu Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien. Das System ist benannt nach dem französischen Verteidigungsminister André Maginot. Es wurde von 1930 bis 1940 gebaut, um Angriffe aus diesen Nachbarländern zu verhindern bzw. abzuwehren.
(Seite „Maginot-Linie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2017, 17:00 UTC. (Abgerufen: 17. Juli 2017, 12:07 UTC))
Inhaltsverzeichnis
Das Fort de Schoenenbourg
Das Fort de Schoenenbourg ist Teil der mehrere hundert Kilometer langen Maginot-Linie und liegt knapp 20 km nordöstlich von Haguenau, nur wenige Kilometer von Wissembourg an der Grenze entfernt. Die Maginot-Linie bestand aus einer vorderen Linie mit Befestigungen und Kasematten sowie aus einer zweiten Linie dahinter mit schwereren Forts mit Artillerie sowie Kasematten. Insbesondere die hintere Linie war nicht durchgängig sondern punktuell in kritischen Gegenden ausgebaut.
Das Fort de Schoenenbourg wurde von 1930 bis 1940 zunächst gebaut und dann ausgebaut. Die Besatzung bestand aus etwa 20 Offizieren, 70 Unteroffizieren und 500 Mannschaften. Der Aufbau basiert auf den Erfahrungen des Stellungskrieges insbesondere bei Verdun im ersten Weltkrieg.
- Vorne sechs Kampfblöcke mit zwei lnfanteriekasematten und vier dreh- und ausfahrbaren Panzertürmen.
- Hinten ein Eingangsblock für Nachschub und ein Eingangsblock für die Soldaten. Die Eingangsblöcke liegen mehr als ein Kilometer von den Kampfblöcken entfernt.
- Dazwischen, in der Nähe der Eingangsblöcke befinden sich Versorgungseinrichtungen wie Kaserne, Küche, Lazarett, Kraftwerk, Wasservorräte, Kraftstoffreserven,
- Unterirdische Tunnel verbinden die Blöcke und die Einrichtungen in einer Tiefe von 18 bis 30 Meter miteinander. Die großen Verbindungstunnel sind etwa 3,5 Kilometer lang. In Richtung Kampfblöcke gibt es dann immer wieder sternförmig Tunnel zu den Geschütztürmen oder zu verschiedenen Einrichtungen.
- Die Geschütztürme hatten unterschiedlich starke Kanonen, teilweise waren es auch nur stark gepanzerte
- Die Geschütztürme ließen sich ausfahren und bei starkem Beschuss wieder versenken.
- Die komplette Energieversorgung erfolgte normalerweise durch eine Starkstromleitung von außen aus dem französischen Hinterland.
- Durch ein Kraftwerk mit Dieselgeneratoren, Verpflegung, Wasser und Munitionsdepots war das Fort unabhängig für etwa 3 bis 6 Monate.
Der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland begann formal mit der Kriegserklärung Frankreichs am 3. September 1939 aufgrund des Angriffs Deutschlands auf Polen. Doch zunächst kam es zum „Drôle de Guerre“ (Sitzkrieg). Erst mit Beginn des Westfeldzugs Deutschlands ab dem 10. Mai kam es zu schweren Kampfhandlungen.
So war es auch beim Fort Schoenenbourg. Vom Mai bis zum Waffenstillstand am 22. Juni feuerten französische und deutsche Truppen tausende von Geschosse aufeinander. 1940 kämpften über 600 französische Soldaten gegen die deutschen Angreifer. Im Fort gibt es viele Fotoaufnahmen, die die von Granaten und Kanonengeschossen umgepflügte Gegend zeigen. Trotz des starken Beschusses auch aus extra angekarrten großkalibrigen Kanonen gab es auf französischer Seite nur zwei Tote, einen durch Feindeinwirkung, den anderen durch einen Rohrkrepierer.
Nach dem Krieg verlotterte die Festung Schoenenbourg viele Jahre. Das Artilleriewerk wurde von vielen Leuten ausgeschlachtet, so dass die ganze Beleuchtung und auch die Stromleitungen weg waren. In den Stollen stand das Wasser. Dann gründeten Freiwillige einen Verein und restaurierten das Fort in vielen Jahren (Website mit Erklärungen, Hinweisen, Öffnungszeiten: „Festung Schoenenbourg„). Inzwischen sind große Teile wiederhergestellt und für Besucher mit unterschiedlichen Öffnungszeiten je nach Jahreszeit geöffnet.
Öffnungszeiten
Das Fort de Schoenenbourg ist in den Sommermonaten Juli und August täglich von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Dieselben Öffnungszeiten gelten sonntags von April bis Oktober sowie an einzelnen anderen Tagen.
In den Monaten April bis Juni sowie September bis Oktober gelten (außer an Sonntagen und einzelnen anderen Tagen) tägliche Öffnungszeiten von 14:00 bis 18:00 Uhr. Auch in den Monaten Dezember bis März ist die Ouvrage an einzelnen Tagen geöffnet.
Die genauen Öffnungszeiten je Tag gibt es auf der Website Lignemaginot.com auf der Einzelseite „Fort de Schoenenbourg – Öffnungszeiten für Einzelbesucher„.
Die Besichtigung
Wir fuhren am Samstag Mittag von Mietesheim aus mit einem kleinen Abstecher über Gundershoffen nach Schoenenbourg. Vom Dorf Schoenenbourg aus gibt es eine beschilderte Zufahrt durch den Wald, und wir waren etwa gegen 13:30 Uhr am Eingang. Das Fort hat zwei Eingänge: Einen für Nachschub und einen für die Soldaten. Die Besichtigung startet am Logistik-Eingang, wo auch eine Schmalspurbahn durch das gepanzerte Tor hinein führte.
Wir waren etwas zu früh dran, die Kasse öffnete um 14 Uhr. Auch ein paar andere Besucher warteten schon. Ein Ticket kostet 8 € pro Person. Dafür geht es nach einer kurzen Erläuterung etwas tiefer in den Stollen und dann links zum Aufzug. Dort konnten sogar die Anhänger der Schmalspurbahn hineinfahren, anschließend geht es etwa 30 Meter in die Tiefe. Wir nahmen die Treppe, die um den funktionierenden (und modernen) Aufzüge herum hinunter führt.
Unten folgten wir der Beschilderung. Es ist keine geführte Tour, doch es gibt überall Schilder und viele Fotos, Karten und Grafiken sowie Erläuterungstafeln in Französisch, Deutsch und Englisch. Immer mal wieder steht eines der Vereinsmitglieder da und erläutert die Räumlichkeiten und die Technik.
Die Tour führt durch die Tunnel zu vier Stationen.
1. Küche und Kraftwerk
Die Küche wurde so wie alles andere nur elektrisch betrieben. Teilweise gibt es noch die originalen Einrichungen, einige Teile waren aufgrund der Plünderungen jedoch verschwunden und wurden durch historische Teile ersetzt. Direkt an der Küche wurde das Essen ausgeteilt. Es gibt keinen Speisesaal für die Mannschaften. Stattessen gab es in den Tunneln Klapptische an der Wand, einige davon sind noch erhalten.
Im Kraftwerk wurde Strom wurde für verschiedene Verwendungszwecke umgewandelt. Außerdem sind dort mehrere Dieselgeneratoren für die autarke Stromversorgung. Ein Vereinsmitglied spielte eine Tonaufnahme eines laufenden Generators in halber Lautstärke ab. Ich konnte nur erahnen, wie die Geräuschkulisse mit allen laufenden Generatoren war. Überhaupt, die Geräuschkulisse. Überall war ein Summen und Rauschen der Belüftungsanlage zu hören. Wenn ich mir jetzt noch ein paar Hundert Soldaten im Alltag und dann den Beschuss vorstelle …
2. Kaserne und Krankenstation
Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere hatten getrennte Unterkünfte. Für die Mannschaften gab es vier Schlafräume mit jeweils 36 dreifach übereinander angeordneten Betten. Die Offiziere hatten eigene Offizierräume mit je nach Position Zwei- oder Dreibettzimmer. Für die Offiziere gab es eine eigene kleine Küche.
Die Krankenstation war für etwa 12 Kranke ausgelegt und hatte sogar einen Operationssaal. Für heutige Standards sieht das ärmlich aus, aber damals war es eben so.
3. Kommandozentrale
Weiter ging es durch die ellenlangen Tunnel. Am Boden verlaufen die Schienen der elektrischen Schmalspurbahn, an der Decke sind die Stromkabel, von denen ein langer schräger Mast sich den Strom zieht.
In der Kommandozentrale waren etwas größere Räume sowie die ganze Kommunikationstechnik. Dazu Lagekarten und Karten mit Schuss-Sektoren für die Artillerie sowie die MG-Nester
4. Kampfbunker
Die Tunnel führen zu den Kampfblöcken mit den Geschütztürmen für die Artillerie. Bei den jeweiligen Geschütztürmen gab es Bunker zur Lagerung der Munition. Bis dorthin konnte Munition mit der elektrischen Schmalspur-Eisenbahn tranportiert werden. In den Munitionsbunkern vor Ort waren die Geschosse in Magazinen gelagert. Diese Magazine waren Metallkästen, die per Kettenzug zum Aufzug gefahren werden konnten. Mit dem Aufzug ging es dann hoch zur Basis der Geschütztürme, wo es ebenfalls noch Lagerkapazität gab.
Die Geschütztürme waren unterschiedlich bestückt: Granatwerfer, Auswurfrohre für Handgranaten, schwere Maschinengewehre, Kanonen. Die Betonwände sind bis zu 3,5 Metern dick. Zuletzt waren wir in einem großen Kanonengeschützturm. Über einen Hebel wird auf der einen Seite der Geschützturm gehoben und damit oben über der Erde ausgefahren. Auf der anderen Seite hängt als Gegengewicht ein riesiger Betonklotz. Der Geschützturm erstreckt sich über drei Stockwerke. Eine Freiwillige des Vereins fuhr den Geschützturm einmal hoch und wieder herunter. Es war erstaunlich, wie ruhig und lautlos das vor sich ging.
Beeindruckend
„Beeindruckend“, das ist wohl das Wort, das die Besichtigung für mich am treffendsten beschreibt. So viel Aufwand, so viel Feindschaft, um dem Gegner den Schädel einzuschlagen oder um dies bei sich zu verhindern. Dazu waren wir im Elsass, das mal zu Frankreich, mal zu Deutschland gehörte. Viele Burgen waren schon Jahrhunderte früher gebaut, erobert, geschliffen worden. Mal von der einen Partei, und mal von der anderen. So wie die Burgen bei Windstein, wo die alte Burg geschliffen und dann die neue gebaut wurde, oder die Burg Lichtenstein, die einmal von Franzosen und dann von Deutschen erobert wurde.
Eine Besichtigung vom Fort de Schoenenbourg lohnt sich auf jeden Fall. Dort unten zu sein und zu versuchen, sich in die Soldaten von damals im Fort und außerhalb des Forts hineinzuversetzen, ihre Gedanken, ihre Ängste. Das ist beklemmend und für unsere Zeit zugleich lehrend. Das sollte es zumindest sein.